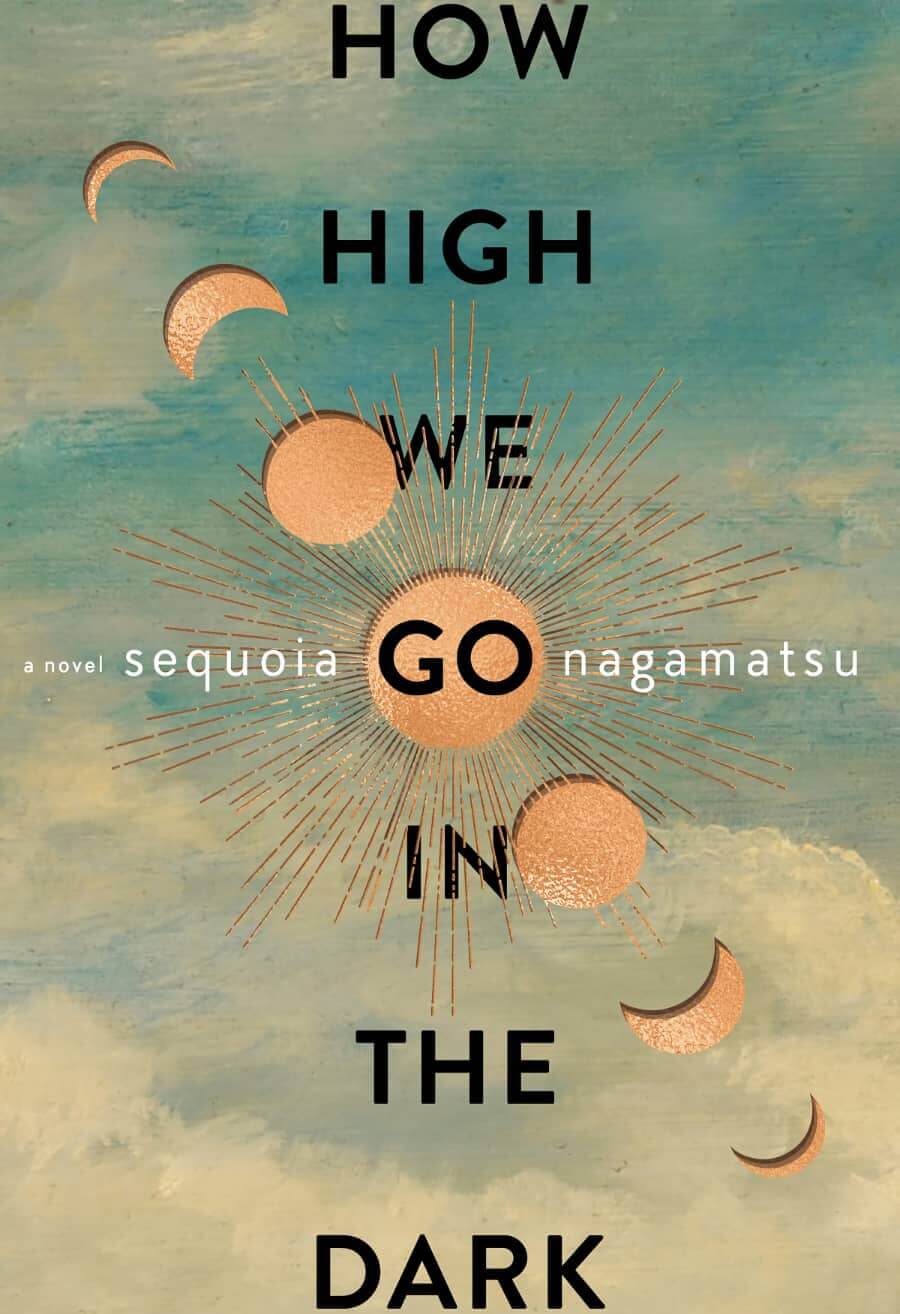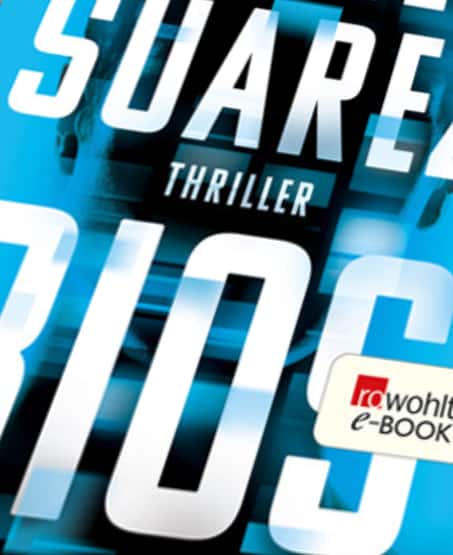Ich bin in letzter Zeit wieder stärker unrund gelaufen. Es spielten verschiedene Faktoren mit rein, die letztendlich zu einem Zustand des Dauer-Gepestet-Seins führten. In der vergangenen Woche habe ich deswegen an allen Strippen gezogen, um mich abends vom Rechner wegzutreiben und die Birne durchzulüften – auch weil das Wetter auch endlich wieder brauchbar war. Nichts gegen Radfahren im Regen, aber ein Kino- oder Ausstellungsbesuch ist halt nicht ganz so geil, wenn du eine Fahrradtasche voller triefend nasser Klamotten mitschleppen musst.
Things I worked on.
Im „Projekt A“ gab es die Entscheidung das weiteres Aussetzen der Frontend-Entwicklungsarbeit aufgrund fehlender Zuarbeiten nicht weiter hinzunehmen. Die Arbeiten haben wieder begonnen.
Im „Projekt B“ habe ich einen Sprint ohne reguläres Ticket und es trotzdem geschafft, jede Woche in den hohen 30er-Stundenzahlen zu kommen, dank eines extrem hohen Anteils an Telkos, Stichwort: Onboarding neuer Mitarbeitenden, Evaluierung von Anforderungen durch neue Drittanbieter und viel „Projektsteuerung“.
Am späten Freitagnachmittag gab es dann noch einen „Überfall“ eines Bekannten. Da sollen für eine Website neue Teilbereiche entstehen. Dabei handelt es sich um eine Nutzeroberfläche für eine Bilddatenbank. Durch ein Kommunikations-Fuck-Up hat der Designer zwar ein Layout geliefert, aber kein pfannenfertiges HTML/CSS etc…-Gedöns … jenes Gedöns, dass am Montag dem Bilddatenbank-Menschen übern Zaun geworfen werden müsste.
Ich habe es am bis Samstagvormittag fertig bekommen. Es war, aus Legacy-Gründen, ein Abstieg in längst vergangene Katakomben der Web-Entwicklung: Bootstrap, jQuery yaddayadda.
Das Basteln von formularlastigen Seiten mit Bootstrap ist kein Spaß. Bootstrap haut häßlich viele unnötige Wrapper und Utility-CSS-Klassen rein. Ich habe mich in meinen Aversionen gegen Utility-CSS (Tailwind, I’m looking at you) bestätigt gefühlt.
Things I did.
Montag: am späten Nachmittag zum Doc in die Hoheluft gefahren.
Danach bin ich die Hoheluftchaussee hoch geschlendert. Ich habe 23 Jahre lang in drei Wohnungen quasi einen Steinwurf entfernt gewohnt und später noch einmal ein halbes Jahr in einer Agentur dort gearbeitet. Ich war über die Gentrifizierung der Hoheluftchaussee erstaunt. Welche Läden es dort nicht mehr gibt, welche dort neu reingekommen sind und wie viele Liefer- und Lebensmittelbringdienste inzwischen abends unterwegs sind.
Danach für sogenannte „Indian Street Kitchen“ ins SVAAdish gefahren. Man macht dort auf authentisches, indisches Essen. Aber es fühlt sich nach Systemrestauration an, die vor allem auf hohen Durchsatz optimiert ist – bei einem Preisniveau, das vergleichbar mit einem klassischen indischen Restaurant ist. Der Hauptraum ist groß und es waren zirka 6 x 5 quadratische Tische aufgestellt. An den Rändern gab es zusätzlich Wandtische und Lounge-Ecken.
Die Vegetable Pakora schienen wie Kugeln aus einem Gemüse-Mix zu sein, die frittiert wurden. Das in den Kugeln verarbeitete Gemüse war nicht mehr identifizierbar – zumindest so lange man nicht auf einen Ingwerstreifen biss. Als Dip gab es Tamarinde Chutney, was ich ketzerisch & ahnungslos als „fruchtige Bratensosse“ beschreiben würde.
Danach nahm ich Chicken Jalfrezi. Das Curry war zwar nicht tomatenlos, aber weiter von cremigen Tomaten weg, als ich es erwartet hatte. Die Hähnchenstücke machten mir nicht den Eindruck, als ob sie mariniert gewesen wären.
Unterm Strich: für diesen Preis darf es gerne restaurantiger und weniger Massenabfertigung sein.
Danach brav mein Leucht-Shirt übergezogen und durch Eimsbüttel, das Niendorfer Gehege und entlang des Flughafens 15,9km mit dem Rad nach Hause gefahren.
Am Dienstag aufgrund eines kolossalen Terminkalender-Fuck-Ups meinerseits, mittags anderthalb Stunden zu früh zu einem Termin in Altona aufgeschlagen und die Zeit mit dem Schlendern durch Ottensen tot geschlagen – und gestaunt über die kurze Halbwertzeit etlicher Läden.
Dann war der Termin und danach durch Altona, Stellingen, Eimsbüttel, das Niendorfer Gehege und entlang des Flughafens 17,6km mit dem Rad nach Hause gefahren.
Am Abend ging es ins Taj Mahal in Langenhorn. Dort nahm ich die gleiche Kombi wie am Montag: Vegetable Pakora und Chicken Jalfrezi. Es war qualitativ weitaus besser und sogar noch einen Hauch günstiger als im SVAAdish.
Die Vegetable Pakora waren feiner frittiert und das Gemüse auch identifizierbar und unterscheidbar. Das Chicken Jalfrezi hatte ein Curry, dass nicht nur dem Namen nach, Tomaten als Basis hatte. Die Hühnchenstücke waren mariniert.
Der einzige Haken am Taj Mahal: man muss Zeit mitbringen. Eine Person in der Küche und eine Person in der Bedienung – macht zwei Stunden.
Am Mittwoch war der vorerst letzte Tag des Films „Die Frau im Nebel“ in den Zeise Kinos in Altona. Also nach Feierabend erst einmal zum Essen ins Salibaba in Eimsbüttel gefahren. Das Salibaba wäre meine Definition von Street Kitchen: gemütlich, aber gleichzeitig unterhalb der Fallhöhe eines veritablen Restaurants, aber oberhalb eines Imbisses.
Der Falafel-Teller war gut. Die Granatapfel-Vinaigrette war auch gut, hat aber viel Säure, auf die meine Zunge nach ca. 80% der Salibaba-Salatmenge, allergisch reagiert.
So gut das Essen war: es ist eine Schande, dass um die Zeit (19 Uhr) sich niemand sonst im Salibaba aufhielt. Stattdessen kamen im 3-Minuten-Rhythmus Lieferbringdienste vorbei, um Essen abzuholen. Das empfand ich in dieser Menge als ziemlich bitter. Kein Wunder, dass Dark Kitchens zunehmen.
„Die Frau im Nebel“ wurde im kleinen Zeise-Kino gezeigt. Filmstart 20h30. Wir waren sieben Personen im Saal. Der Film endete kurz vor 23 Uhr. Danach brav mein Leucht-Shirt übergezogen und durch Altona, Stellingen, Eimsbüttel, das Niendorfer Gehege und entlang des Flughafens 17,2km mit dem Rad nach Hause gefahren. Passend zum Film „Die Frau im Nebel“: im dichter werdenden Nebel.
War es die Kälte in Kombination mit der Feuchtigkeit? Die Fahrt hat mich fertig gemacht. Zuhause musste ich mich auch erst noch runter fahren – es wurde also eine kurze Nacht und den Donnerstag war ich recht alle – auch bedingt durch eine anspruchsvolle Telko, von der ich erst eine halbe Stunde vor Beginn erfuhr.
Und so kamen zwischen Montag und Freitag 104 Kilometer auf dem Rad zusammen.
Things I read.
Die
Ich habe angefangen, den über 650 Seiten starken Hardcover-Band zu lesen, der die zwanzig „Die“-Hefte von Kieron Gillen/Stephanie Hans zusammen bündelt.
Erste Eindrücke: ich lese es sehr gerne, weil sich im Laufe der Hefte ein interessantes, ambivalentes Beziehungs-Geflecht zwischen den Protagonisten offenbart. Ich bin fasziniert, vom Gewicht, das auf den Schultern der Zeichnerin Stephanie Hans lastet, um die abstrakten Kulissen auf Papier zu bringen und wie sie damit farblich umgeht.
Derzeit nimmt die Bewertung Kurs auf vier oder fünf Sterne.
Things I watched.
Die Frau im Nebel
… ist ein ästhetisch sehr ansprechender Film vom „Oldboy“-Regisseur Park Chan-wook. Er kommt hier ohne jene größeren physische Grausamkeiten oder andere Ekeligkeiten aus, die ich wg „Oldboy“ befürchtet hatte.
Es ist die Geschichte eines Kommissars, der in einer Fernbeziehung lebt, und der Ehefrau eines Mordopfers. Die Witwe, ein chinesischer Flüchtling, wird zwar anfänglich verdächtigt, kann aber ein Alibi vorweisen. Der Kommissar observiert die Frau, fängt aber im Laufe der Beschattung an, sich in die Frau zu verlieben.
Aufgrund des Alibis werden die Ermittlungen beendet und der Kommissar trifft sich mit der Frau. Durch einen Zufall kommt der Kommissar darauf, dass das Alibi der Witwe falsch war und sie letztendlich den Mord begangen hat – zu spät: alle Beweismittel sind vernichtet und seine Gefühle für die Frau sind zu groß. Er ist zerstört, wird depressiv und lässt sich in die Stadt seiner Fernbeziehung versetzen.
Ein Jahr später taucht die Frau in dieser Stadt auf. Mit einem neuen Ehemann. Und jener Ehemann wird einige Tage später tot im Swimmingpool aufgefunden…
Der Film „funktioniert“ auf zwei Ebenen. Ästhetisch ist der Film fantastisch fotografiert und es ist sehenswert, wie Park Chan-wook die Szenen visuell miteinander verwebt.
Die zweite Ebene wird durch die Schauspielerin Tang Wei geprägt, die Schauspielerin der Ehefrau/Witwe, die es schafft, das (Männer?)Herz zu erweichen und sehr empathisch zu wirken, aber gleichzeitig auch über zwei Stunden die Ambivalenz aufrecht hält: Hat sie nun? Ist sie nun? Wird sie nun?
Ich habe den Film und seine Perma-Melancholie sehr gemocht – aber gleichzeitig ist es wie ein Duft gewesen, der am nächsten Morgen wieder verflogen war. Ich habe den Film so sehr gemocht, dass ich ihm vier von fünf Sterne geben würde. Aber gleichzeitig hat der Film keine tiefen Spuren hinterlassen, so dass es eigentlich nur drei von fünf Sternen wären.
Ant-Man
„Ant-Man“ ist so ein Film, der nicht wirklich schlecht gemacht ist, aber vermutlich exakt dem Feindbild entspricht, das Leute vor ihren Augen haben, wenn sie verächtlich von den ganzen Marvel-Filmen sprechen.
Der Film ist einer weitere Iteration des hinlänglich bekannten Marvel-Filme-Kochrezeptes. Eine Person wird unfreiwillig ein Superheld (hier: Einbrecher entdeckt im Tresor einen Superhelden-Anzug). Person ist ungläubig, widerwillig und bis zum Anschlag selbstironisch, besitzt aber einen guten Kern und wird daher zum Retter.
Dazu fügt man noch einige Mentoren und Buddys und machtbesessene Bösewichter in den Brei. Fertig ist der Film.
Kannste halt gucken, während du den Haushalt machst, weil der Film völlig überraschungs- und nuancenfrei ist. Als Anbieter wie Marvel musst du dich aber auch fragen, inwieweit du dein Angebot mit solcher Dutzendware verwässerst?
Zwei von fünf Sternen.
Thor
Vier Jahre älter als „Ant-Man“ ist der erste Marvel-Film zu Thor. Im Vergleich zu „Ant-Man“ nutzt er die Chancen seiner Vorlage, um öfters aus dem Marvel-Einheitsbrei auszubrechen. Selbst wenn nicht alles gelungen ist, sorgten alleine die „Ausbruchsversuche“ dafür, dass man öfters hinguckte.
Da ein Teil der Handlung auf Ebene der nordischen Götter respektive Asgard, spielte, konnten die gängigen Erzählmuster verlassen werden. Optisch bot Asgard ein aufwändiges, neues Set-Design, das teilweise speierbrechend kitschig war, teilweise schon in Game of Thrones durchgespielt wurde. Aber immerhin konnte man sich angucken, wie denn die Regenbogenbrücke Bifröst aussieht (wie in einer funky 70er-Jahre Disco… nun ja).
Erzählerisch durchaus spannend waren die Familienkonflikte der nordischen Götter. Insbesondere Loki/Tom Hiddleston brachte da Subtilität rein.
Das Geschehen auf der Erde wirkte dagegen vergleichsweise banal und fiel ab.
Was mir inhaltlich aufstösst, ist die krasse Abweichung von der originären Herkunftsgeschichte Thors, Stichwort gehbehinderter Arzt Dr. Don Blake. Aber da bin ich vielleicht zu sehr Traditionalist.
Drei von fünf Sternen.
Coming up
Es ist die Sprint-Übergangswoche in „Projekt B“, weswegen einige längere Telkos anfallen und andere, kürzere Telkos entfallen. Morgen werde ich für den Sprintwechsel Ticketpflege machen.
Ich muss in einem Pro-Bono-Projekt vorwärts kommen.
Ich habe mir grob einen Ausstellungsbesuch ausgeguckt und versuche Urlaubsplanungen für März/April aufzugleisen.